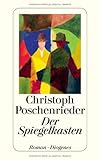Defilée der Traumata
Christoph Poschenrieder kokettiert in seinem Roman „Der Spiegelkasten“ mit Kriegstraumata und Wohlstandspsychosen
Von Clarissa Höschel
In Christoph Poschenrieders zweitem Roman „Der Spiegelkasten“ geht es um einen Offizier im Ersten Weltkrieg, dessen Psyche sich mit verschiedenen Tricks vor den traumatisierenden Kriegserlebnissen zu schützen sucht. In einem parallel angelegten Erzählstrang entwickelt ein Großneffe dieses Offiziers, ein eher unsympathischer Wohlstandslümmel, eine Psychose, weil er sich zu intensiv mit den Fotoalben des Großonkels befasst. Beiden gemeinsam ist der Verlust der Bodenhaftung – was den einen im Krieg vor dem Wahnsinn rettet, verschafft dem anderen in Friedenszeiten freien Zugang zur Couch eines Psychiaters.
Schlüsselsymbol ist der (historisch aus der Mitte der 1990er-Jahren stammende) Spiegelkasten, ein therapeutisches Hilfsmittel zur Behandlung Amputierter, der auf verschiedene Weise die Geschehnisse symbolisiert und, so weiß man im Nachhinein, auch vorwegnimmt – eine brillant-simple Erfindung mit ungeahnten Möglichkeiten (auch im realen Leben), über die nachzudenken sich in jedem Fall lohnt. Dass das Foto des Spiegelkastens, im Krieg heimlich aufgenommen, verwackelt und verschwommen ist, ist stimmig; dass es dem irre gewordenen Großneffen am Ende abhanden kommt, ist es nur bedingt – aber das kann auch Ansichtssache sein.
Erzähltechnisch aufwändig gestaltet, kennt der Roman zu Beginn drei Zeitebenen – zwei feste und eine variable, die chronologisch am weitesten zurückliegt und gerade deshalb wohl im Präsens gehalten ist. Die beiden Hauptebenen sind die Erlebnisse des Protagonisten im ersten Weltkrieg und die Erzählergegenwart des Großneffen und Ich-Erzählers. Die Idee ist gut, der Ansatz auch – wenngleich zu Beginn etwas mühsam, aber man liest sich rasch ein und denkt sich ebenso schnell hinein. Mittendrin wird es fast gemütlich, vielleicht, weil man als Leser eine stabile Position zwischen Onkel und Neffe gefunden hat. Doch dann beginnen die Handlungsstränge, sich zu verdrehen und gegen Ende immer schneller anzunähern, denn beide Protagonisten durchleben dasselbe, das gleiche oder zumindest etwas Ähnliches, nämlich eine ausgemachte Ich-Störung (wenngleich mit unterschiedlichen Vorzeichen). Nun wird es ungemütlich auf dem Beobachtungsposten zwischen den Welten, weil plötzlich die vielgerühmte Verschmelzung von Realität und Fiktion eintritt, die im Grunde schon seit der ersten Seite im Gange ist und deshalb nicht plötzlich zu einem Problem werden muss, das man in Panik erstickt wie einen übersehenen Zimmerbrand. Entsprechend kurz ist der Schluss – ein kurzer Schluss, ein Kurzschluss, und alles ist viel zu schnell vorbei, ohne dass der Leser bis zu diesem Schluss auf seine Kosten gekommen wäre.
Hat man die abrupte Landung einigermaßen verkraftet, fragt man sich, weshalb Ismar Manneberg, der Protagonist, explizit Jude sein muss, wenn doch die Konfession mit der eigentlichen Geschichte nichts zu tun hat – es sei denn, die Wissenschaft hätte mittlerweile herausgefunden, dass Kriegstraumata konfessionsabhängig sind. Oder sollte die Loyalität eines Juden zu einer deutschen Armee – hier: der königlich-bayerischen – manifest werden? Vielleicht sein Anspruch auf Anerkennung seitens der nichtjüdischen Deutschen? Auch eher nicht, denn dafür fehlt die Eigenständigkeit dieses Handlungselements. Und so bleibt Mannebergs Judentum ein unnützes Anhängsel (ein Fähnchen im Winde der political correctness?), auf das ab und an, in einem unwichtigen Nebensatz, Bezug genommen wird, damit es nicht ganz umsonst war. Auf die Geschichte hat es aber, wie gesagt, keinen Einfluss. Durchaus zur Geschichte gehörend, aber deutlich zu kurz gekommen ist dagegen der schwarze Panther, der als Symbol der Angst und des Unterbewussten funktionalisiert ist und deutlich mehr Auslauf verdient hätte.
Und Ariadne mit dem Faden? Auch sie steht dem Protagonisten gut, solange man nicht stolpert über Fäden, die einem eigentlich den Weg weisen sollten. Hier nestelt der Erzähler zu sehr herum, wo ein beherzter Griff dem Ganzen deutlich zuträglicher gewesen wäre. Das hätte auch Rechenmacher so gesehen, wenn man ihn denn gefragt hätte. Übrigens die überzeugendste Figur, die den Protagonisten aus der zweiten Reihe heraus immer wieder ins rechte Licht zu rücken weiß.
Alles in allem sind die Zutaten durchaus ausgefallen, machen neugierig und hätten mit etwas Geschick ein kulinarisch anspruchsvolles Drei-Gänge-Menü ergeben können, an das sich der Gaumen gerne erinnert. Nun ist es nur ein bürgerliches Mittagsmahl geworden – schade.
|
||